Kennt ihr das, wenn ihr ein Buch lest und überhaupt nicht versteht, wo es hin will und wo der rote Faden ist und eigentlich nicht mal, worum es überhaupt geht? Kennt ihr das, wenn man lange überlegt, ob man es einfach abbrechen soll und dann liest man es doch zu Ende und am Ende versteht man, dass es ein gutes Buch war? Nein? Kannte ich auch nicht. Und dann habe ich „Lincoln im Bardo“ von George Saunders gelesen.
Auch wer sich nicht allzu gut mit der Geschichte der USA auskennt (so wie ich, bevor ich „Hamilton“ gesehen habe… Schleichwerbung! GUCKT „HAMILTON“!), hat wahrscheinlich schon mal etwas von diesem Abraham Lincoln gehört. Ich meine jetzt nicht den aus dem Kino, der Zombies jagt, sondern den großen Mann mit dem lustigen Zylinder, der im Theater erschossen wurde und nicht so auf Sklaverei stand. Im Roman von Saunders wird die Geschichte eines Abschnitts aus Lincolns Leben erzählt, von dem ich bis dato nichts wusste. Während des Bürgerkrieges verstarb sein Sohn Willie an Typhus. Wie Lincoln darauf reagierte, lesen wir in diesem Buch. Allerdings nicht aus der Perspektive des ehemaligen Präsidenten, sondern aus zahllosen anderen. Bei den Erzählern handelt es sich dabei primär um Tote, nämlich jene, die in einer Art Zwischenwelt auf dem Friedhof mit Willie verharren, da sie nicht bereit sind, ihren Tod zu akzeptieren. Eine Nacht lang beobachten wir also einen Mann, der um seinen Sohn trauert und hören dabei die Geschichten derer, die sich sonst noch so auf dem Friedhof herumtreiben.
Die fragmentarische Erzählweise hat mich einerseits sehr angestrengt, gleichzeitig lasen sich die 445 Seiten dennoch irre schnell, was ich zuvor auch noch nicht erlebt habe. Hervorzuheben ist die absolut großartige Übersetzung von Frank Heibert, der es geschafft hat, zahlreiche Perspektiven aus verschiedenen Zeitaltern und Lebensabschnitten glaubwürdig wiederzugeben, Saunders teils poetische Sprache beizubehalten und vor allem dessen mitunter schwarzen Humor weiterzutragen. Absolut gelungen!
Dennoch: ich habe mich über weite Strecken schwer getan, mit diesem Buch. Ich habe nachwievor das Gefühl, es nicht einmal ansatzweise verstanden zu haben, den Eindruck, dass mir viel entgangen ist.
Die surreale Erzählweise hat diesen Eindruck oft verstärkt.
Allerdings geht es hier um Trauer, um den Tod, um den Verlust des eigenen Kindes – Dinge, die nun einmal absolut ungreifbar und nicht zu verstehen sind, was der Text lediglich widerspiegelt.
Während ich also manchmal über mehrere Seiten hinweg versuchte herauszufinden, was da gerade überhaupt passiert, gab es andere Stellen, die mir die Tränen in die Augen und die Gänsehaut auf die Arme trieben. Da berichtet zum Beispiel einer der „Geister“ von all den Dingen, die ihn in der Welt festhalten:
[E]ine Meute Kinder, die durch querwehendes Dezembergestöber trottete, ein freundliches Feuergeben unter einer unfallschiefen Straßenlaterne; im hohen Uhrturm, eingefroren, Vogelbesuch; kaltes Wasser aus einem Zinnkrug; Abtrocknen des feuchten Hemdes im Nach-Juniregen. Perlen, Lumpen, Knöpfe, Teppichflausch, Bierschaum.
S. 431 f.
Usw. Über Seiten.
All diese wunderbaren Kleinigkeiten, die man nicht bemerkt, weil sie so schrecklich selbstverständlich sind, die das verdammte Leben aber nun mal einfach ausmachen.
Saunders hat eine verdammt melancholische, traurige, schöne und manchmal witzige Aufforderung geschrieben, das Leben mit all dem Guten und mit all der Scheiße zu lieben.
Für mich war „Lincoln im Bardo“ eine absolut neuartige Leseerfahrung auf verschiedenen Ebenen, über die ich gern sprechen würde.
Habt ihr es auch gelesen? Wie ging es euch mit diesem Buch?


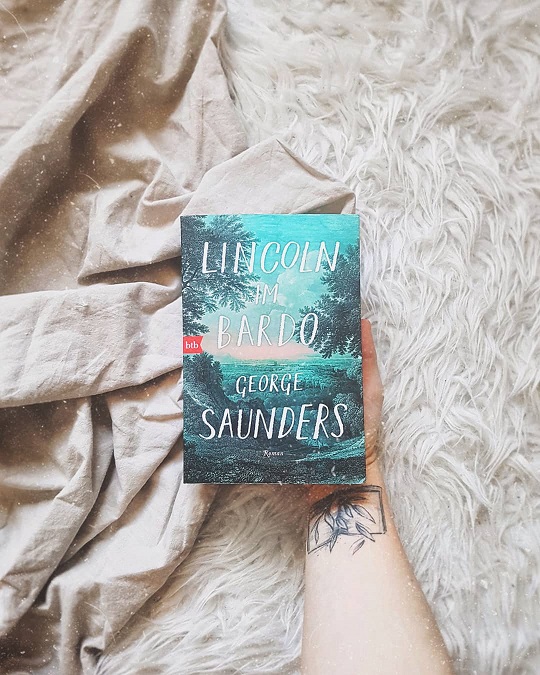
Schreibe einen Kommentar